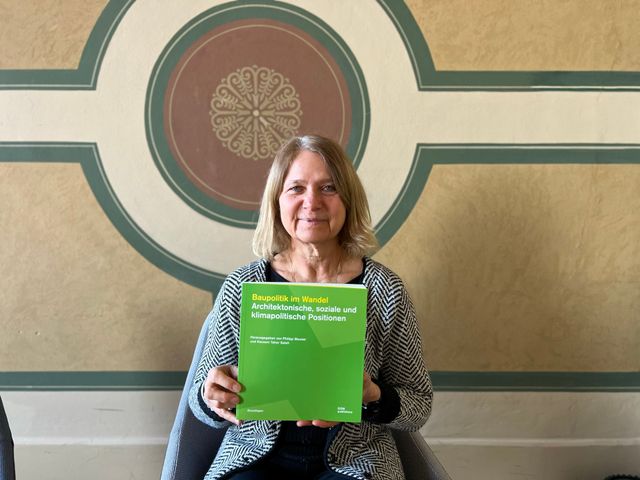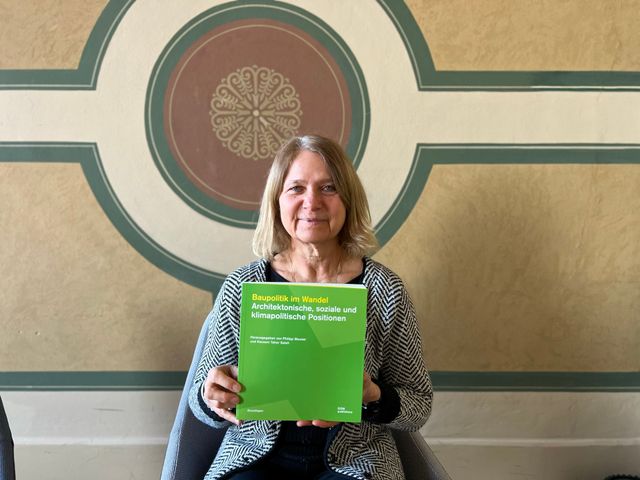In Zeiten steigender Baupreise, immer deutlicheren Klimawandels und drohender sozialer Ungleichheit stehen Städtebau und Architektur an einem Wendepunkt. Stimmen aus der Bauwirtschaft, der Politik und der Forschung widmen sich in dem Grundlagenband "Baupolitik im Wandel" der dringenden Notwendigkeit eines Umdenkens in der Baupolitik Deutschlands.
Von der Übernutzung von Ressourcen bis zur kritischen Frage, wie wir zukünftig mit Neubauten umgehen – acht Autoren und Autorinnen analysieren existierende Paradigmen und zeigen auf, welche innovativen Ansätze möglich sind, um Wohnraummangel zu bekämpfen und zugleich Klimaziele zu erreichen. Neben Elisabeth Broermann, Franziska Eichstädt-Bohlig, Daniel Fuhrhop, Andrea Gebhard, Emanuel Heisenberg, Philipp Meuser und Kassem Taher Saleh durfte ich ebenfalls einen Beitrag verfassen.
Zehn Überlegungen für eine ökologische Bauwende
1 Gute Architektur braucht gute Politik
Die Baupolitik in Berlin erlebte ich als Studentin in den Jahren 1977 bis 1983 sowie als Bundestagsabgeordnete in den Jahren 2002 bis 2005. Vor der Wende wohnte ich in der Manteuffelstraße in SO36 ziemlich nahe an der Mauer, als Abgeordnete dann in der Danckelmannstraße in Charlottenburg. Ich studierte im Berlin der Hausbesetzerzeit an der Hochschule der Künste, selbst kam ich aus der Welterbestadt Bamberg, in die ich nach dem Studium zurückkehrte. An der Hochschule der Künste waren (aus der Bauhausbewegung kommend) bereits die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit im Lehrplan verankert, die soziale Lage war ganz selbstverständlich immer inkludiert. In meinem Semester war mein Studienfreund Matthias Sauerbruch, der bereits damals schon in seinen Entwürfen Nachhaltigkeitsprinzipien realisierte. Ich selbst experimentierte gern, ein Studienaufenthalt in Beni Mellal (Marokko) öffnete mir die Augen für globale Zusammenhänge, traditionelle Bau- und Lebensweisen, und ich entwickelte damals meine Liebe zum Lehmbau, aber auch zur Diversität. Das Beobachten, wie und wann sich Menschen wohlfühlen, was sie benötigen, ist für mich bis heute ein Ur-Anliegen, das Kulturen miteinander verbindet. In meiner Studienzeit erlebte ich, wie der Spekulationsdruck in Berlin zur Hausbesetzerrevolte führte; Mietshäuser der Gründerzeit sollten entweder abgerissen werden für teure Neubauten oder sie wurden luxussaniert.
In dieser Gemengelage fand in Berlin eine Internationale Bauausstellung unter der Regie von Hardt-Waltherr Hämer und Josef Paul Kleihues statt. Der eine stand für die IBA Altbau, der andere für die IBA Neubau. Der eine prägte die behutsame Stadterneuerung, der andere die kritische Rekonstruktion von Stadtquartieren. Wir profitieren von dieser baupolitischen Meisterleistung noch heute: Die Mitsprache von Bürgern und Bürgerinnen wurde eingeführt (ich war selbst bei einer sehr langen Sitzung dabei), das ökologische Bauen, das Füllen von Baulücken, experimentelle Wohnformen, Umnutzung statt Neubau; aber auch verschiedene Stilrichtungen wurden zugelassen, internationale Architekten setzten ihre gestalterischen Marken: Aldo Rossi, Rob Krier, Zaha Hadid, Raimund Abraham, Herman Hertzberger, John Hejduk, Álvaro Siza oder Oswald Mathias Ungers, Inken und Hinrich Baller, Otto Steidle, Peter Stürzebecher (Wohnregal zum Selbstausbau). Diese Internationale Bauausstellung, auch IBA 84 / 87 genannt, hat baupolitisch sozial, nachhaltig und weltoffen gewirkt und bis heute ihre Spuren im ganzen Lande gelassen. Jede IBA ist ein ausgezeichnetes baupolitisches Instrument, im politisch geschützten Raum in einem Zeitfenster von einer Dekade gesellschaftlich relevante Bedürfnisse aufzunehmen, zu interpretieren und räumlich umzusetzen.
Der gesamte Beitrag zum Download:
Das gedruckte Buch "Baupolitik im Wandel. Architektonische, soziale und klimapolitische Positionen", Herausgegeben von Philipp Meuser
und Kassem Taher Saleh ist bei DOM Publishers erhältlich.